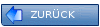Beiträge: 0
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
13 gesamt
(gesamt: 0)
Jetzt online
0 Benutzer
13 gesamt
Hauptforum
Paranormal Deutschland
e.V.

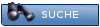

Hauptforum Heilerforum Hexenforum Jenseitsforum Literaturforum OBE-Forum Traumforum Wissensforum Nexus Vereinsforum ParaWiki Chat

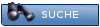

(BETA) Links zu Beiträgen, Artikeln, Ressorts und Webseiten, die zu diesem Beitrag passen könnten (Alle bisher vermerkten Stichwörter und URLs):
Bewusstsein: Geheimnis des BewuÃtseins Energie: Bewusstsein&Materie (wiki) Edelstein: Edelsteine Energie: Energievampir (wiki) Energie: Batterie von Bagdad (wiki) Handlesen: Die Kunst des Handlesens (*) Humor: Humor (rubrik) Test: Regeln für Experimente (wiki)
Für Jenere/Macht
U-Bahn-Boris schrieb am 13. Dezember 2004 um 11:17 Uhr (642x gelesen):
Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel
1. Spiele um Macht und Ohnmacht1
Bei allen wettbewerbsorientierten Spielen, von Sportspielen, Geschicklichkeitsspielen, Kreisspielen bis zu Gesellschaftsspielen, geht es (auch) um Macht und Ohnmacht der Spieler: Habe ich die Macht, ein Tor zu schießen? Muß ich ohnmächtig zusehen, wie der Ball im Korb landet? Die eigenen Fähigkeiten werden bedeutsam in bezug auf diese Macht: Reichen die Fähigkeiten von mir (oder meiner Mannschaft) aus, das Spiel zu „machen“? Oder sind die Fähigkeiten im Vergleich zu denen der anderen Spieler so unzureichend, daß wir gegenüber dem „machtvollen“ Spiel unserer Gegner „ohnmächtig“ (also ohne Macht) unserer Niederlage entgegensehen müssen? Können wir Fähigkeiten und Kräfte so bündeln und koordinieren, daß wir damit etwas „machen“ können? Aus diesem „Machen“ erwächst dann möglicherweise die „Macht“, mit der wir das Spiel entscheiden können. Oder erweisen wir uns, indem was wir „machen“, als „machtlos“ gegenüber den „Spielmachern“ der gegnerischen Mannschaft?
Die Sprache signalisiert es bereits: Bei bestimmten Spielen geht es um die Macht, das Spiel zu „machen“. Im Spiel vollzieht sich ein „Ringen“ mit einem Gegner, der alle seine Macht einsetzt um zu gewinnen. Das Reizvolle und Spannende dieser Spiele liegt darin, daß vor Beginn des Spiels noch nicht feststeht, wer gewinnen, sich also als der „Machtvollere“ erweisen wird. Die Spielhandlungen sind Versuche, auf die Machtbalance einzuwirken, sie zu seinen Gunsten zu verändern.
Macht und Ohnmacht im Spiel finden unmittelbare Entsprechungen im Leben aller Menschen. Jeder wird Situationen von Macht und Ohnmacht erlebt und die Erkenntnis ausgebildet haben, daß diese Erfahrungen etwas damit zu tun haben, daß mein Gegenüber mehr (oder auch weniger) Macht besitzt (oder eingesetzt hat) als ich selbst. Was „Macht“ letztlich „machtvoll“ „macht“, hängt von vielen Faktoren ab: eigene Fähigkeiten und Kräfte, situative Bedingungen, wechselseitige Erwartungen und vieles andere. Der Aspekt der „Macht“ bestimmt mehr oder weniger alle menschlichen Beziehungen, sei es zu anderen Menschen, zu Gegenständen oder zur Natur. Das Überleben des einzelnen Menschen und der Menschheit schlechthin hängt davon ab, ob die eigene „Macht“ (d.h. die auf die Umwelt wirkenden Fähigkeiten und Kräfte) ausreicht, sich ein Verbleiben auf dieser Welt zu sichern. Im wettbewerbsorientierten Spiel wird dieser Aspekt des „Spiels des Lebens“ ausgefaltet und inszeniert. Das Gewinnen und Verlieren entscheidet über das „Bleiberecht“: Welche Mannschaft hat Bestand? Welche kann ihren Platz in der Liga behaupten? Welche steigt auf, welche steigt ab?
Zum Leben aller Menschen gehören Gefühle der unzureichenden Macht: nicht „machtvoll“ genug zu sein gegenüber der Macht des anderen; „ohnmächtig“ sich der Macht eines anderen beugen zu müssen; Strategien entwickeln zu müssen, sich der „Macht“ des Gegenübers entziehen zu können; „gewappnet“ zu sein, gegenüber der sich der entwickelnden „Macht“ eines anderen.
Und genau an diesem Punkt knüpfen Computerspiele an. Sie bieten vielfältige Spielräume, in denen sich auf unterschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen Thematiken „Macht“ entwickeln und sich gegenüber gegnerischer „Macht“ behaupten muß. Wir werden nun anhand von drei typischen Beispielen zeigen, welche „Angebote“ zum Umgang mit „virtueller Macht“ gemacht werden und welche Bedeutung diese „Angebote“ für die „Erwartungen“ der Spieler haben können.
1. Machtvoll gerüstet: Sehr effektvoll in Bild und Ton führen die „Shooter-Games“ vor, über welches „Waffenpotential“ die virtuellen Welten verfügen. Ausgerüstet mit diesen Waffen „kämpft“ der Spieler um sein „Bleiberecht“ in der virtuellen Welt. Vom „angemessenen“ Gebrauch der „machtvollen“ Waffen hängt es ab, ob der Spieler „überleben“ kann. Eines der sehr erfolgreichen Spiele dieser Art wollen wir jetzt vorstellen: „Turrican II“.2
Handlungsträger des Spiels ist ein Kampfroboter. Mit Hilfe dieses „elektronischen Stellvertreters“ bewegt sich der Spieler laufend, springend und vor allen Dingen um sich schießend durch eine futuristische Welt. Er muß Berge erklimmen, sich durch Grotten kämpfen, Wasserfälle überwinden, Brücken überqueren und vieles andere. Überall wimmelt es nur so von „Feinden“: andere Roboter in unterschiedlicher Gestalt, Pflanzen, Insekten, Monster, Kampffische. Diese gilt es, machtvoll zu „erledigen“. Wegen der Vielfältigkeit und Gefährlichkeit der Bedrohungen sind „Extrawaffen“ unverzichtbar. Nur machtvoll gerüstet kann der Spieler das Spiel „beherrschen“ und die Spielabläufe „kontrollieren“. Angefeuert durch „fetzige“ Musik und berauscht durch die Wirkkraft seiner „mächtigen Waffen“, entfaltet sich Schritt für Schritt eine „futuristische Welt“. Aufmerksamkeit, Konzentrationskraft und Handlungsgeschick sind erforderlich, um darin die nächsten Minuten „überleben“ zu können.
Mit Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit allein ist es nicht getan. Der Spieler muß zudem sorgfältig die „Umgebung“ beobachten und auch kleinste Details – trotz der enormen Anspannung – wahrnehmen, ihre Bedeutung herausfinden und für das Vorankommen im Spiel nutzbar machen. So gibt es z.B. kleine Bildsymbole, die bei Anklicken das „Waffenarsenal“ des Spielers wirkungsvoll ergänzen und auf diesem Wege eine „machtvolle Nachrüstung“ bewirken. Die Fähigkeit, sich räumlich in dieser virtuellen Welt orientieren zu können, ist ebenfalls erforderlich, um das Spiel zu beherrschen.
Die „Inszenierung“ des Spiels (Grafik, Sound, Animation, Abwechslungsreichtum) ist vollauf gelungen und gut auf männliche Jugendliche abgestimmt. Was aber ist inszeniert worden?
Um was geht es also in „Turrican II“? Mit seiner machtvoll aufgerüsteten Spielfigur erlebt der Spieler in der virtuellen Welt eine ständig vorhandene und sich fortlaufend steigernde Bedrohung. Dieser steht der Neuling zunächst recht ohnmächtig gegenüber. Das Scheitern in dieser Welt scheint unabwendbar. Erst die „richtige Einstellung“ (zum Spiel) und eine machtvolle Ausrüstung bieten die Chance, nicht mehr „ohne Macht“ zu sein. Als hochgerüsteter Maschinenmensch erwehrt sich der Spieler den vielfältigen Bedrohungen, zeigt sich in seiner „Macht“, steigert sie durch permanentes Training und fegt dann wie in Turrican durch die „Landschaft“ und „erledigt“ alles, was bedrohlich erscheint – immer weiter und weiter, einem fernen Ziel entgegen: die vollständige Entfaltung dieser virtuellen Welt.
Während des ganzen Spiels steht der Spieler in dem Zwang zwischen „erledigen“ müssen oder „erledigt“ werden – bis er nach vielen Versuchen selbst physisch und psychisch „erledigt“ ist. Er erwirbt im Laufe des Spiels eine spezifische „Erledigungsmacht“, die sein „Überleben“ im Spiel sichert. In der Entwicklung der Handlungsmacht des Spielers entfaltet sich das Spiel und gibt nach und nach seine virtuelle Welt preis. Die Entfaltung der virtuellen Welt ist an das Handeln des Spielers zwingend gebunden. Seine Person, seine Gefühle, Assoziationen, Erinnerungen, Erfahrungen, Handlungsmuster, Wünsche und Träumen fließen über dieses Handeln in das Spiel ein. Die virtuelle Welt wird „lebendig“, wenn der Spieler sie mit „Leben“ füllt: seinem Leben und seiner Lebenszeit. Erst indem der Spieler das Geschehen auf dem Bildschirm handelnd zu sich in Beziehung setzt, entsteht aus dem „Angebot“ einer virtuellen Welt eine „Geschichte“, die sich innerhalb der Grenzen und Möglichkeiten einer spezifischen virtuellen Welt entwickeln kann.
Damit der Spieler sein Leben und seine Lebenszeit verwendet, damit in der virtuellen Welt eine „Geschichte“ entsteht, muß etwas in dieser „Geschichte“ für den Spieler bedeutsam sein: also auf etwas deuten, was außerhalb des Geschehens auf dem Bildschirm liegt. Das Spiel „Turrican“ bietet dem Spieler eine Folie für machtvolles Handeln in gefahrvollen Umgebungen. Das Spiel selbst ist eine Metapher für unsere reale Welt, wie sie für viele Jugendliche eines bestimmten Altersabschnitts erscheint und von ihnen erlebt wird: voller Gefährdungen, Belastungen, Bedrohungen und Einschränkungen und damit voller Hindernisse für den Wunsch, im Leben voranzukommen. Das Spiel bietet auf der metaphorischen Ebene für diese Probleme nachvollziehbare und d.h. handlungsrelevante Lösungsmöglichkeiten: Man muß den vielfältigen Aufgaben Rechnung tragen und sie „erledigen“. Dabei ist es wichtig, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten, zu verstärken und zu lernen, bestimmte Situationen zu durchschauen, um angemessen auf sie reagieren zu können. „Turrican“ bietet dem jugendlichen Spieler unendlich wiederholbare „Bewährungssituationen“, in denen er sich „machtvoll“ für den Lebenskampf „ausrüsten“ kann. Am Ende tritt an die Stelle von Ohnmacht vor den vielfältigen Gefährdungen in der Welt das Gefühl, soviel „Macht“ zu besitzen, daß man die Herausforderungen annehmen, die „Erledigungssituationen“ bewältigen und auf dem „Weg des Lebens“ vorankommen kann. Insofern kann das Spiel zu einer „Selbstmedikation“ gegen das Gefühl werden, den Forderungen des Lebens nicht zu genügen, weil die Macht zu ihrer Erfüllung nicht ausreicht.
2. Dem Abgrund entronnen: Wohl kaum einem Menschen werden im Laufe seines Lebens Gefühle erspart, vor einem „Abgrund“ zu stehen, in einem „Lebensstrom“ bewegt zu werden, der einen fortträgt, ohne daß man etwas dagegen tun könnte. Um diese Gefühle der Ohnmacht und um spielerische Möglichkeiten, diese Ohnmacht in machtvolles spielerisches Verhalten zu kehren, geht es in „Lemmings“.
Inzwischen sind sie wohl schon jedem Computerspieler bekannt: die Lemminge, wuselige kleine Wesen, die unbeirrt durch die Gegend laufen. Dabei drohen ihnen vielfältige Gefahren, die sie von sich aus nicht abwenden können. Aber zum Glück gibt es den cleveren Computerspieler, der ein wachsames Auge auf „seine“ Lemminge geworfen hat. Er muß zusehen, daß die kleinen Wesen unbehelligt ins Ziel gelangen. Wie macht er das? Er überlegt, welchen Weg die Lemminge zum Ziel gehen könnten, welche Hindernisse im Wege stehen und wie man sie beseitigen kann. Und hier beginnt der besondere Reiz des Spiels: Normalerweise ist jeder Lemming ein „Walker“, ein Fußgänger ohne besondere Fähigkeiten, der einfach nur geht und umkehrt, wenn er auf ein Hindernis stößt. Je nach Spielstufe steht es dem Spieler frei, einige seiner Lemminge in „Spezialisten“ zu verwandeln: z.B. in einen „Kletterer“, einen „Fallschirmspringer“, einen „Buddler“ (jeweils für senkrechte, waagerechte und diagonale Löcher), einen „Blocker“ und einen „Brückenbauer“. Mit Hilfe dieser „Spezialisten“ kann der Spieler den „Wanderweg“ der Lemminge so gestalten, daß die meisten von ihnen sicher ans Ziel gelangen. Wichtig dabei ist, die richtige Eigenschaft dem richtigen Lemming zur richtigen Zeit zuzuordnen, wenn der Ausflug der Lemminge nicht im Fiasko enden soll.
Die ersten Szenarien sind (für etwas Ältere) noch recht einfach und helfen, die Handlungsmöglichkeiten im Spiel kennenzulernen. Fehler wirken sich nicht unbedingt und sofort spielentscheidend aus. Die Anforderungen an den Spieler sind noch nicht so hoch, die Möglichkeiten des Scheiterns geringer. Dies ändert sich jedoch recht bald. Dann wird nicht nur die richtige Strategie spielentscheidend sein, sondern auch das präzise Timing. Der Spieler muß herausfinden, welche Spielhandlung zu welchem Zeitpunkt unabdingbar notwendig ist, um die Spielaufgabe zu erfüllen. Dazu kann es manchmal erforderlich sein, einzelne Lemminge zu „opfern“, d.h. in die Luft zu sprengen, um den nachfolgenden Lemmingen den Weg freizumachen.
Das Spiel „Lemmings“ hat sich als einer der Hits für das Jahr 1991 herausgestellt, so daß pünktlich zu Beginn des Jahres 1992 das Fortsetzungsspiel auf den Markt gelangt ist: „Oh, NO! More Lemmings“. Was macht den besonderen Reiz dieses Spiels aus?
Ohne Frage ist „Lemmings“ ein sehr gut gemachtes Spiel. Grafik und Sound sind gelungen; man kann sich gut auf dem Bildschirm orientieren und versteht rasch das Spielprinzip. Die spielerischen Herausforderungen steigen recht langsam an und bieten damit (für Kinder wie für Jugendliche und Erwachsene) gute Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich zu entfalten. Die Spielidee, Lemminge auf ihrem Weg zum Ziel zu unterstützen, ist im Grunde recht simpel und rasch zu verstehen. Reizvoll sind die vielfältigen Möglichkeiten, die in dieser Spielidee stecken und die durch sehr unterschiedliche Labyrinthe und Denkanstrengungen immer wieder neu und belebend wirken.
Von besonderem Reiz für jüngere wie ältere Spieler sind die gut auf einander abgestimmten Spielforderungen. „Lemmings“ bietet eine überaus gelungene Mischung aus Geschicklichkeit, Taktik, Reaktion und Kombination. Die Spieler müssen durchdenken, welchen Weg die Lemminge nehmen können, welche „Spezialisteneigenschaften“ wann und für welche Figuren notwendig sind und wann die Eigenschaften geändert werden müssen. Dabei stehen die Spieler in den schwierigeren Levels vor dem Problem, daß sie nur in begrenztem Umfang, „Spezialisten“ bestimmen können. Gleichwohl müssen sie eine vorgegebene Anzahl von Lemmingen ins Ziel bringen. Dies ist mit intensiven Denkanstrenungen verbunden. Aber nicht nur das: Der Spieler muß seine Vorstellungen schnell und häufig sehr präzise umsetzen. Er muß auch in der Lage sein, kurzfristig umzudisponieren (wenn er z.B. nicht geschickt oder schnell genug war) und andere Möglichkeiten spontan zu entwickeln. Gefordert werden Kreativität in der Entwicklung von Lösungen, vorausschauendes Denken, exprimentelles Verhalten und die Fähigkeit, nach dem Muster von „Versuch und Irrtum“ zu lernen. Zudem steht der Spieler bei höheren Levels unter Zeitdruck und muß mit dieser Streßbelastung klarkommen.
Der Reiz des Spiels, den sich Kinder und Jugendliche nur schwer entziehen können, hängt auch damit zusammen, daß sich Kinder und Jugendliche mit ihren spezifischen Wünschen, Vorstellungen und Erfahrungen darin wiederfinden können. „Lemmings“ bietet ein recht komplexes Reizangebot mit vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten. Die witzig animierten Figuren knüpfen an die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit lustigen Zeichentrickfilmen an. In der Hintergrundthematik vielen dieser Filme ähnlich, inszeniert auch „Lemmings“ Situationen, in denen die Kleinen ohnmächtig sind und sich darum bemühen müssen, Macht zu erlangen.
Zu Beginn des Spiels steht der Spieler ohnmächtig vor dem blinden Gang der Ereignisse. Er sieht sich mit einem Selbstlauf konfrontiert, der den eigenen Eingriffsmöglichkeiten entwunden scheint: Die Lemminge laufen und laufen ... und steuern ihrem Abgrund entgegen. Nun hat der Spieler jedoch Macht; er muß sie lediglich erkennen und einen angemessenen Gebrauch davon machen. In dem Maße erwächst dem Spieler Macht,
* als er sich Kenntnisse über die verschiedenen „Spezialisten“ und ihre Wirkungen verschafft,
* als er diese „Spezialisten“ zu koordinieren lernt,
* als er sich auf „antizipatorisches Denken“ einläßt, also überlegt, was bei welchen Spielhandlungen passiert,
* als er „vorausschauendes Denken“ in seine Überlegungen einbezieht, also durchdenkt, was in welcher Reihenfolge zu geschehen hat,
* als er akzeptiert, aus Fehlern zu lernen, neue Einfälle auszuprobieren und Funktionsmuster für die „Welt der Lemminge“ auszubilden.
Diese im Spiel geforderten (und geförderten) Fähigkeiten verleihen nicht nur im Spiel, sondern (bezogen auf andere Sachverhalte) auch in unserer Gesellschaft Macht: eine Handlungsmacht, die beim Werkzeuggebrauch ebenso zum Tragen kommt wie beispielsweise beim Hausbau, bei der Organisation von Arbeitsprozessen, der Planung von Forschungsvorhaben oder der Konzipierung von Werbestrategien. Entwickelt man diese Handlungsmacht nicht, muß man sich ohnmächtig in den „Zug der Lemminge“ einreihen: auf der Stelle treten oder sich dem Abgrund zubewegen.
In „Lemmings“ trainiert der Spieler seine Handlungsmacht. Er erhält dazu die Macht, die Lemminge zu lenken, und die Verpflichtung, für ihre Geschicke Verantwortung zu tragen. Nicht umsonst fühlen sich manche Spieler bei „Lemmings“ an ihre Rolle als „älteres Geschwisterteil“ erinnert, das auf jüngere Geschwister aufzupassen, in begrenztem Umfang Verantwortung zu übernehmen und Kontrolle auszuüben hat.
„Lemmings“ ist der inszenierte Mythos, daß Menschen durch Denken und Geschicklichkeit ihre Geschicke werden lenken können und daß es von daher notwendig ist, bestimmte eigene Fähigkeiten auszubilden und sie gezielt zu verwenden. Diesem Grundmuster des Spiels kann man ein Geflecht von Sinnbezügen, wechselseitigen Verweisungen und Lebenserfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen zuordnen. Ob Elternhaus, Schule oder Beruf: Überall wird man mit „machtvollen“ Sitationen konfrontiert, in denen man zeigen muß, daß man Handlungsmacht erworben hat. Ohnmacht entsteht immer dann, wenn man ohne die Macht, angemessen handeln zu können, dasteht: bei der Mathematik-Arbeit ebenso wie bei der Reparatur eines Rohrbruchs oder der Kontrolle eines Arbeitsablaufs.
3. Blick vom Feldherrenhügel: Macht und Ohnmacht sind beherrschende Faktoren in militärischen Auseinandersetzungen. Dort, wo Blut fließt, erweist es sich in letzter Konsequenz, wer Macht besitzt und wer die Macht des Anderen ohnmächtig ertragen muß. Schlachten werden nicht geführt, wenn unter den Beteiligten klar ist, wer die entscheidende Macht hat und wer sie nicht hat. Ist dies jedoch unentschieden, kommt es zum Gefecht, bei dem jeder Beteiligter seine Macht einsetzt und erprobt, ob sie ausreicht, die Macht des Gegners zu überwinden oder nicht.
In der Rolle eines Befehlshabers wird man zu einem „Machtträger“, der über Leben und Tod von Menschen und Menschengruppen entscheiden kann. Nicht Umfang und Fülle der Macht ist es, die an dieser Rolle fasziniert, sondern die Wirkung dieser Macht auf andere Menschen. Während die Machtfülle eines Top-Managers unternehmerische Entscheidungen in Milliardenhöhe bewirken kann und allenfalls indirekt auf Menschen einwirkt, hat der Angriffsbefehl eines Generals auf Hunderte und Tausende von Menschen unmittelbare tödliche Wirkung. Daß dieser Angriffsbefehl im Grunde nur eine „Machtexekution“ darstellt, nicht unmittelbar eigener Machtfülle entstammt, sondern nur ein Bestandteil (neben vielen anderen) in der Machtstruktur des Staates ist, soll nicht unerwähnt bleiben. Mit anderen Worten: Über Krieg und Frieden entscheidet nicht der General; er führt lediglich aus, was bereits vorentschieden ist. Sein „handwerkliches Können“ verleiht der Machtinstanz des Staates Gewicht, Wirksamkeit und damit Macht – und zwar in dem Rahmen, als diese Machtinstanz „Handwerkszeuge des Krieges“ zur Verfügung stellen kann.
Mit dieser Verwobenheit der Machtstrukturen eines Staates wird man in der Regel nicht konfrontiert, wenn man sich auf die Computersimulation einer Schlacht einläßt. Das Spiel „Gettysburg“ steht exemplarisch für eine ganze Reihe ähnlicher Spiele, bei denen die Spieler die Techniken und Verfahren der „Machtexekution“ anhand historischer Schlachten kennenlernen und erproben können. In ihre Hand wird es gelegt, Geschichte zu verändern: „... with Gettysburg you can rewrite history.“ Und das ist eine Form der Macht: „The power to change American history“.
Wie übt der Simulationsspieler seine „Macht“ aus? Er wählt die Rolle eines der beiden kommandierenden Generale an dieser für den amerikanischen Bürgerkrieg wohl wichtigen Schlacht. Durch schriftliche Befehle an seine Korps-Kommandeure versucht er nun, die Schlacht für sich zu entscheiden und die gegnerische Armee (die vom Computer oder einem menschlichen Mitspieler geführt wird) zum Rückzug zu zwingen. Dazu muß er die verschiedenen Befehle kennen und etwas über ihre Auswirkungen in dieser Schlachtsimulation wissen. Das sehr umfangreiche Handbuch macht den Spieler mit militärhistorischen und miltärtaktischen Besonderheiten dieser Zeit vertraut und gibt damit Hilfestellung, in die Rolle eines Armeebefehlshabers hineinzuwachsen. Der Spieler kann die Wirkungen seiner Befehle vom „Feldherrenhügel“ oder – wenn er dies will – von jedem Punkt des Schlachtfeldes verfolgen und sich flexibel auf die Entwicklung der Schlacht einstellen. Er kann sich auch von seinen Korps-Kommandeuren Berichte über die Schlacht schicken lassen.
Gemessen an den sehr „lebendigen“ und aktionsreichen Computerspielen wirkt „Gettysburg“ eher langweilig: Alles geht recht langsam; Veränderungen stellen sich lediglich im 30-Minuten-Takt der Simulation ein. Bewegliche Figuren, auf die man, wie bei „Turrican II“, unmittelbar Einfluß haben könnte, gibt es nicht. Das spielerische Handeln ist nicht aktional-direkt, sondern strategisch-indirekt. Der Spieler befiehlt nicht unmittelbar über Joystick, sondern verwendet für seine Befehle bestimmte Sprachformeln wie z.B. „Hancock defend Little-Round-Top“ oder „Longstreet order your infantry to attack Big-Round-Top“. In seinem Geschick liegt es, die richtigen Befehle zur richtigen Zeit zu geben, das Geschehen auf dem Schlachtfeld richtig einzuschätzen und eine angemessene Strategie zu entwickeln.
Auch grafisch macht das Spiel nicht viel her. Schlachtfeld und militärische Einheiten wirken recht schematisch. Die Farbgebung dient lediglich zur Orientierung und Kennzeichnung. Das Spiel ist vom „grafischen Naturalismus“ vieler neuer Videospiele sehr weit entfernt. Abgesehen von einem mäßig gelungenen „Soundtrack“ zu Beginn des Spiels und dem Knallen von Kanonen (wenn man sie denn hören will) ist bei „Gettysburg“ soundmäßig nichts los. Wenn man nun glaubte, das Spiel liefe – wegen dieser sparsamer Ausstattung – schnell ab, fühlt sich rasch eines Besseren belehrt. Selbst an den schnellsten Computern dauert es häufig „kleine Ewigkeiten“, bis der Computer alles für den nächsten Spielzug berechnet und grafisch umgesetzt hat.
Trotz all dieser Begrenzungen übt das Spiel (speziell auf junge Erwachsene) eine enorme Faszinationskraft aus, für die es schwer fällt, auf den ersten Blick hinlänglich überzeugende Gründe zu finden. Sicher geht es bei „Gettysburg“ um Macht: um die Macht, die Glieder einer Armee so zu lenken, daß diese Armee (und damit man selbst) sich als machtvoller erweist als der Gegner. Ging es bei „Lemmings“ darum, eine Armee von wuseligen, wirklichkeitsentrückten Wesen den richtigen Weg zu weisen, so geht es bei „Gettyburg“ um Menschenarmeen, die auf konkrete historische Ereignisse bezug nehmen.
Wie bei „Lemmings“ so auch bei „Gettysburg“ gibt es „Spezialisten“, die bestimmte Aufgaben übernehmen können. In einer Schlacht heißen die „Spezialisten“ z.B. Artillerie, Infanterie, Kavalerie. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Spielen besteht darin, daß die Spezialisten bei „Lemmings“ wie ein „Schraubenzieher“ funktionieren: Ihre Wirkung ist genau angebbar und kalkulierbar. Ganz anders bei „Gettysburg“: Es steht nicht von vornherein fest, ob ein bestimmter Trupp von „Spezialisten“ auch „ganze Arbeit“ leisten wird. Vieles verliert sich im Komplexen und Unbestimmbaren. Das erstreckt sich auch auf die Befehlsgebung: Ob ein Befehl rechtzeitig ankommt, ob er angemessen ausgeführt wird und ob er die beabsichtigte Wirkung erzielt, steht nicht von vornherein fest. Es entzieht sich vielmehr der Macht des Befehlshabers – zumindest zu einem Teil. Obwohl es vage und unbestimmt bleibt, kann man doch bei einiger „Erfahrung“ abschätzen, wie welche Befehle ankommen und wie sie vermutlich wirken werden. Nur mit absoluter Gewißheit läßt sich dies nicht sagen.
Woran liegt das? Der Spieler muß sich mit einem interaktiv verbundenen Gegenüber einlassen. Dessen mögliches Verhalten muß man bei den eigenen Spielzügen angemessen in Rechnung stellen: Was könnte mein Gegner tun? Welche Handlungsmöglichkeiten blieben mir dann? Diese interaktiven Denkprozesse, die wesentlich zum Spielreiz beitragen, machen es notwendig, Ziele zu bestimmen, Kräfte und Mittel bereitzustellen, Wirkungen abzuschätzen und vor allen Dingen: flexibel zu bleiben – denn es kommt (manchmal) anders als man denkt. Das Umgehen mit Unbestimmtheit, Komplexität und Unberechenbarkeit sowie die Notwendig, etwas „in den Griff zu bekommen“, kann für bestimmte Spieler eine reizvolle Herausforderung sein.
Die spielerischen Herausforderungen sind möglicherweise eine Quelle des Spielreizes. Weniger bedeutsam scheint bei „Gettysburg“ der Umstand zu sein, sich als „machtvoller Erwachsener“ erweisen zu können, mit der Möglichkeit, durch das spielerische Handeln „Geschichte zu verändern“. Der Spieler fühlt sich im Spiel sehr schnell an die Grenzen seiner eigenen Macht erinnert. Ob seine Befehle die beabsichtigte Wirkung haben, ist ungewiß. Ungewiß ist sogar, ob die Unterbefehlshaber, diese Befehle überhaupt ausführen oder sie nur schlicht ignorieren. „Gettysburg“ ist wahrhaftig kein Spiel, um ungehemmten Machtrausch genießen zu können.
Es ist vielmehr ein Spiel, das jungen Erwachsenen in der Symbolstruktur einer Schlacht etwas von dem widerspiegelt, was auf einer intrapsychischen Ebene einen bestimmten Wiedererkennungswert hat. Armeekorps und Divisionen, Artillerie, Kavalerie und Infanterie sind „Metaphern“ für eigene Kräfte, Fähigkeiten, Leistungen und Handlungsmöglichkeiten. Diese eigenen Potentiale stoßen bei ihrer Entfaltung und Ausdehnung auf Widerstände, werden (wie bei einer Schlacht) beeinträchtigt, vermindern sich, reiben sich an anderen Kräften, verschleißen sich, stagnieren oder treten den Rückzug an. Man denke z.B. an einen jungen Erwachsenen, der mit den ihm zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen an Kraft, Zeit, Geld bestimmte Dinge erreichen möchte: im Beruf, in seiner Partnerschaft, bei seinen Freizeitbeschäftigungen, in seinem Freundeskreis. Er muß nun Schwerpunkte setzen: In bestimmten Bereichen kann er wirkungsvoll sein und sich „ausdehnen“, andere konfliktträchtige Bereiche kosten viel Kraft und zehren an seiner „Lebensenergie“, ohne daß damit Erfolge oder Veränderungen verbunden wären.
Wieder andere Aspekte der Lebenssituation machen es notwendig, sich zurückzuziehen und den Kontakt „auszudünnen“. Durch Erfahrungen klüger wird der junge Erwachsene sehr bald die Notwendigkeit erkennen, eigene „Reserven“ zu bilden und sich nicht völlig zu verausgaben.
Das Ausbalancieren der eigenen Kräfte, die Ziel- und Schwerpunktsetzung, die richtige Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen, die zutreffende Beurteilung von Hindernissen, Konflikten und Beeinträchtigungen sind Fähigkeiten, die sowohl im Leben von Jugendlichen wichtig sind als auch bei „Gettysburg“. Mit anderen Worten: In der Simulation dieser Schlacht (und vieler anderer) spiegeln sich sowohl gesellschaftliche Kräfte, historische Ursprünge und Verhaltensgewohnheiten der Menschheit als auch Bemühungen des Spielers, die eigene Identitätsentwicklung voranzubringen und auszubalancieren. Indem „Gettysburg“ die Lebensorientierungen des Spielers auf die Folie einer Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg spannt und sie mit Hilfe der Simulation zur Darstellung bringen läßt, entsteht für den Spieler eine ungeheure Faszinationskraft. Es geht nun nicht mehr nur um eine beliebige Schlacht, sondern um den Spieler selbst. Indem er dieses „Entgegenkommen“ des Spiels akzeptiert hat, füllt er die Schlacht mit seinem Leben und macht daraus die Schlacht seines Lebens. Er „belebt“ das Spiels, weil er sich davon „beleben“ läßt und sein „Leben“ darin zu „leben“ beginnt – ein „Leben“, das sich nach den Prinzipien von Macht und Ohnmacht orientiert.
2. Spieler zwischen Macht und Ohnmacht
Anhand von drei Beispielen haben wir gezeigt, welche „Angebote“ Computerspiele zum Bereich „Macht und Ohnmacht“ bereithalten. Wie gehen Spieler mit diesem „Angebot“ um? Dieser Frage wollen wir nun anhand von mehreren breit angelegten empirischen Untersuchungen nachgehen, die an anderer Stelle umfassend dargestellt sind3
2.1. Kontrollwünsche und Kontrollverluste
Spielkontrolle und damit Spielerfolge stehen eindeutig im Mittelpunkt der Spielmotivation. Nahezu alle Befragten äußerten sich direkt oder indirekt zum Problem der Spielbeherrschung und zu den emotionalen Wirkungen bei Kontrolle des Spiels bzw. bei Kontrollverlust. Der Spaß am Spiel steigt beträchtlich, wenn man in der Lage ist, den Spielforderungen zu genügen: das Spiel zu verstehen, die Spielfigur angemessen zu führen, die Spielaufgabe zu lösen und ins nächste Level zu kommen: „Das Spiel macht Spaß, weil ich meistens immer so weit komme, ganz weit, ich war einmal ganz bis zum Ende. Das war ein tolles Gefühl“ (Schüler, 11 Jahre).
Das Gefühl, ein Spiel kontrollieren zu können, ist insbesondere für Kinder so stimulierend, daß sie immer wieder zu den Spielen greifen, in denen sie Erfolg hatten: „Ich hab’ auch Spiele, die kann ich. Die sind einfach zu gut zum Wegwerfen. (...) Ich hab’ die im Kasten, und wenn ich mal Lust auf dieses Spiel hab’, dann nehm’ ich mir das raus und spiel das. Auch wenn das Spiel schon erledigt worden ist. Alle Level durchgegangen oder so. Zum Beispiel ,Wonder Boy`, da komm ich ja durch und da probier’ ich das immer wieder neu. Ich hab’ das jetzt dreimal durchgeschafft und zehnmal gespielt“ (Schüler, 15 Jahre). Auch jüngere Spieler orientieren ihre Spielvorlieben nach Spielerfolgen, die mit diesen Spielen möglich sind: „Manche Spiele sind auch schwer. Aber die ich kann, die ich gut finde, die spiele ich fast immer“ (Schüler, 11 Jahre).
Aber wo die Lust winkt, ist der Frust nicht weit. Sehr viele Äußerungen beinhalten (teilweise massive) Unlusterfahrungen, die mit Verlusten der Kontrolle des Spiels verbunden sind. Dies gilt für Jungen ebenso wie für Mädchen. Es beginnt mit Gefühlen der Aufregungen und Unruhe, wenn man es nicht geschafft hat, wenn man einfach nicht weiterkommt, wenn es nicht gelingt, die Spielfigur angemessen zu führen: „Ich habe mich da ein bißchen schon aufgeregt, wo ich etwas nicht geschafft habe. Ich konnte auf einen Stein nicht hoch“ (Schülerin, 14 Jahre). In die gleiche Richtung geht die Äußerung einer 17jährigen Schülerin: „Also, weil man da nie so genau wußte, was man tun sollte, fand ich das so’n bißchen, na ja, nicht schwierig, aber nach ’ner Zeit ging einem das schon auf ’en Keks, weil ich da nicht weiterkam.“
Die frustrierende Situation führt häufig dazu, das Spiel nach einiger Zeit zu beenden: „Wenn es überhaupt nicht weitergeht, dann spiel’ ich nicht gern. Wenn man 10 Minuten davor sitzt, oder 20, und dann immer noch nicht weiterkommt, dann find’ ich das ein bißchen blöd“ (Schülerin, 14 Jahre). Der Ärger, mit dem Spiel nicht klarzukommen, kann dazu führen, immer rasch aufzuhören und sich dem Computerspiel nicht intensiv zuzuwenden, so z.B. bei diesem 13jährigen Mädchen: „Wenn ich mich zuviel ärgere bei einem Spiel, dann höre ich auf. Also ich kann nicht spielsüchtig werden, weil ich mich immer zuviel ärgere und damit aufhöre. Also, wenn mich etwas ärgert, dann mache ich den Computer aus. Darum komme ich beim Gameboy-Spielen nicht weiter.“
Heftige Wutreaktionen auf Kontrollverluste im Spiel sind kein Ausnahmefall: „Ich reg’ mich meistens total auf. Könnte ich lieber in die Ecke klatschen, wenn es nicht klappt. Wenn ich es schon so oft probiert habe, da krieg’ ich Wut. Das geht mir besonders beim Videospielen so“ (Schülerin, 16 Jahre). „Wenn es nicht weitergeht, hau ich dann immer die Maus auf den Tisch, und dann mach’ ich aus. Mich wundert’s, daß die Maus noch nicht kaputt gegangen ist. Die lebt also noch“ (Schülerin, 14 Jahre). In diesen aggressiven Reaktionen stehen die Jungen den Mädchen in nichts nach: „Wenn ich bei einem Spiel sofort am Anfang verliere oder fünfmal hintereinander, dann werde ich auf einmal sauer. Dann fange ich an, zu dem Spiel Schimpfwörter zu sagen“ (Schüler, 13 Jahre).
Jungen geraten nicht selten bei Mißerfolgen im Spiel in eine Frustrations-Aggressions-Spirale. Trotz andauernder Bemühungen will es ihnen einfach nicht gelingen, Kontrolle über das Spiel auszuüben. Dies führt zu immer heftiger werdenden aggressiven Gefühlen: „Wenn ich etwas im Spiel nicht schaffe, dann mache ich immer weiter, bis ich es schaffe. (...) Das geht an die Nerven. Ich habe schon einmal einen Gameboy von mir kaputt gehauen, weil ich nervös war“ (Schüler, 11 Jahre). Von den heftigen aggressiven Gefühlen bei Kontrollverlust bleiben auch ältere Spieler nicht verschont, so z.B. dieser 17jährige Schüler: „Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da teilweise einen Ausflipper, daß ich dann, was weiß ich, wenn irgend etwas nicht geht, dann schmeiße ich das Joypad in die Ecke oder so etwas in der Art. Aber bis jetzt hat’s noch alles überlebt eigentlich. Und meine Mitmenschen ärgern sich, daß ich mal wieder das ganze Haus unterhalten würde, wenn ich dann etwas meinen Ausflipper habe, aber na gut.“
Spieler mit größeren Spielerfahrungen, die die Wirkungen der Frustrations-Aggressions-Spirale an sich selbst erfahren haben, können verschiedene Techniken entwickeln, um ein Anschwellen der Ärgerreaktionen zu vermeiden: „Ich habe immer Spiele mit Codes. Da kann man am nächsten Tag immer weiterspielen. Ich stelle mir das immer so vor: Ich habe ja einen Computer, da kann ich am nächsten Tag nochmal neu versuchen. Und ärgern tue ich mich nicht. Vielleicht manchmal nur“ (Schüler, 11 Jahre).
Eine Hilfe, aus der Frustrations-Aggressions-Spirale herauszukommen, hat diese 15jährige Schülerin gefunden: „Wenn ich z.B. in ’nem Level bin und merke, das schaffe ich nicht, dann denke ich: verdammt nochmal! Und ich schaff das nicht, dann hol’ ich mir meine kleine Schwester: ,Mach das ’mal für mich, damit ich weiter komme.‘ Sonst eigentlich nicht.“ Ähnlich das Verhalten eines 15jährigen Schülers: „Und wenn ich das überhaupt nicht schaffe, dann mache ich das aus und warte dann. Rufe einen Freund an und frag, ob der es kennt. Und dann irgendwie kriegt man das schon hin. Das ist kein Hindernis.“
Soviel Zuversicht braucht man schon, wenn man all die Hindernisse beseitigen will, die der Kontrolle des Spiels entgegenstehen: „Ich rege mich fast bei jedem Spiel auf am Anfang, wenn man nicht reinkommt. Besonders bei der Hubschraubersimulation am Anfang. Da bin ich andauernd nach 5 Minuten schon abgeschossen worden. Und dann war die Diskette noch kaputt. Und dann stürzt man ab. Da habe ich echt so einen Hals gekriegt“ (Schüler, 18 Jahre). Sind aber die Frustrationen überwunden und hat man gelernt, das Spiel zu beherrschen, ändert sich das Bild bei ihm: „Wenn ich das Spiel anfange zu beherrschen, ja, dann spiele ich damit ziemlich lange. Also mit der Hubschraubersimulation habe ich jeden Tag zwei bis drei Stunden gespielt, so am Anfang, und nachher hat es auch nachgelassen.“
Um den „Kampf um die Kontrolle“ zu gewinnen, stehen viele „Freunde“ in zahlreichen Zeitschriften, Büchern und Lösungsheften mit „heißen“ Tips bereit, um vom Tal des Frusts möglichst rasch in die lichten Höhen der Lust aufsteigen zu können. Aber nicht nur das: Die Industrie hält ganze Sortimente von Joysticks bereit, damit jeder den „Freudenstab“ finden kann, der die Kontrolle des Spiels optimal ermöglicht: „Ja, weil ich habe einen Joystick, der ist ganz hart, und einen, mit dem kann man machen, wie man will. Und die Joysticks sind total anders. Mit meinem komme ich besser zurecht, weil, der hat vier Feuerknöpfe, da brauche ich nicht immer unten zu drücken. Die habe ich direkt an der Handlehne. Da habe ich direkt den Feuerknopf. Da brauche ich unten nur zu halten (Schüler, 13 Jahre).
2.2. Vom Motiv der Spielkontrolle beherrscht
Für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist das Motiv, das Spiel zu beherrschen und zu kontrollieren, es zu „schaffen“, in den Mittelpunkt ihres spielerischen Interesses gerückt: „Dat geht uns auch hauptsächlich nicht wegen den Spielen, sondern wegen dem Reiz, das zu schaffen“ (Patrick, 15 Jahre). Selbst bei Jüngeren, so bei diesem 11Jährigen, steht das Erfüllen der Spielforderungen im Mittelpunkt: „Ich habe ja ein Sega-Master-System, und da gibt’s ein Spiel, das schaff’ ich durch, und dann noch Mickey Mouse, das schaff’ ich auch durch. Ich schaffe alle meine Spiele fast durch. Und ich habe viele Spiele.“
Das Motiv der Spielkontrolle ist insbesondere für die älteren „Vielspieler“ bestimmend. Nach durchgeführten Untersuchungen mit mehr als hundert dieser „Spielexperten“ steht bei 97,2% der Erfolg im Spiel im Mittelpunkt.4 Um das Spiel zu schaffen, muß man die entsprechende Kompetenz besitzen oder in den vielfältigen Spielversuchen ausbilden: „Wenn ich so ein Spiel neu lerne, dann bin ich nie gut darin. Aber wenn ich es ’nen paarmal gespielt habe, dann verbessere ich mich schon dabei“ (Orhan, 12 Jahre). Aber meist ist dies nicht so einfach.
Auf dem Weg zum Spielerfolg erleiden die Spieler nur zu oft herbe Enttäuschungen, die deutliche Wut- und Ärgerreaktionen hervorrufen: „Ich werd’ langsam sauer, wenn ich immer an der gleichen Stelle oder so kaputt gehe“ (Kai, 15 Jahre). Heftigere Reaktionen auf Spielverlust zeigt Marcel (10 Jahre): „Manchmal ärgere ich mich über ein Spiel. Also, wenn ich richtig sauer bin, dann zerschlage ich fast den Bildschirm.“ Auch Mädchen berichten über deutliche Gefühle des Sauerseins, wenn es im Spiel nicht so klappt, wie sie es sich wünschen. Vielfach wird berichtet, daß Freunde bei Spielverlust heftige Wutgefühle zeigen: „Ein Freund von mir, der war irgendwie ganz normal vorher, also gar nicht wütend oder so. Und als er gespielt hat, danach war er total wütend, weil er immer verloren hat“ (Kim, 15 Jahre). Offensichtlich steht beim Computerspiel mehr auf dem Spiel als „nur“ ein Spiel: Es sind die eigenen Kompetenzen, die im Computerspiel ins Spiel kommen und deren Wert man durch das Spielgeschehen bestätigt sehen möchte.
Um die Ärgerreaktionen unter Kontrolle zu bringen, entwickeln die Jugendlichen bestimmte Techniken, so z.B. Denis (14 Jahre): „Manchmal rege ich mich wirklich richtig auf. Aber manchmal laß ich’s einfach, mach es aus und habe keine Lust mehr. Aber manchmal, da bin ich ganz schön aufgeregt: Mach’ den Computer aus, hör’ Musik und leg’ mich ’was hin. Dann ist es o.K.. Dann mach’ ich halt was anderes und denk’ nicht mehr dran.“ Hat man sich jedoch erst einmal richtig auf das Spiel eingelassen und viel Zeit und „Lebenskraft“ investiert, erscheint ein Rückzug nahezu unmöglich, weil inzwischen zuviel auf dem Spiel steht: „Bei dem Spiel ,Fire and Ice‘ bin ich immer an einer Ecke gescheitert. Immer wieder habe ich dieselbe Bewegung gemacht, immer wieder! Aber es hat nicht geklappt! Da bin ich fast verrückt geworden. Am liebsten hätte ich den Computer kurz und klein geschlagen. Da mußte ich mich total abreagieren. Mit dem Hund rausgehen, frische Luft schnappen und auf andere Gedanken kommen. Oder einfach ein anderes Spiel spielen, wo ich ein Erfolgserlebnis habe. Das läßt mir keine Ruhe. Irgendwann habe ich es dann auch geschafft. (...) Ein Spiel einfach so aufzuhören, das kann ich nicht. Da muß ich solange ausprobieren, bis es endlich klappt“ (Christian, 14 Jahre).
Mit dem Zwang, ein angefangenes Spiel unbedingt schaffen zu müssen, steht dieser Jugendliche nicht allein: „Ich versuche immer, das Spiel zu schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich immer weiter, bis ich es schaffe, und das dauert so 5 Stunden. (...) Manche Spiele schaff’ ich ja. Drei Monate habe ich dafür gebraucht“ (Ahmet, 13 Jahre).
Hat man es schließlich geschafft, den Spielforderungen zu genügen, stellen sich meist Gefühle des Stolzes und der Zufriedenheit mit der eigenen Leistung ein: „Wenn man ein Spiel neu kriegt und so richtig spielt und weit kommt, ja dann hat man auch so ein gutes Gefühl, daß ich das jetzt wieder geschafft habe“ (Karsten, 16 Jahre). Eng verbunden mit dem Erfolgsgefühl ist das Bewußtsein, im Spiel Macht zeigen und Kontrolle ausüben zu können: „Daß man zum Beispiel bei `Hotel Mananger’ die Herrschaft dann hat. Die Putzfrau kommt raus, dafür hol’ ich mir einen Barkeeper. Daß man eben viel Macht hat“ (Joachim, 14 Jahre).
Daneben spielen Gefühle der Kompetenz, der Leistungssteigerung und der darauf bezogenen Gratifikationen eine große Rolle: „Es reizt mich irgendwie alles. Die ganze Tastatur, und vor dir ist ein Gegner, und du mußt ihn abschießen. Und wenn du die Mission erfüllst: Medaillien und alles Mögliche. Tja, dann hat man ein gutes Gefühl natürlich! Und dann kommst du immer weiter. Dann kriegst du größere Schiffe und Flugzeuge und so. Da kann man sich immer verbessern. Das ist schon angenehm. Also da hat man immer mehr Lust. Da möchte man nicht mehr aufhören“ (Cihan, 16 Jahre).
Nur: diese Gefühle verblassen sehr schnell und bedürfen daher der Bestätigung durch neue Erfolge in neuen Spielen. So wird, gleichgültig ob Erfolg oder Mißerfolg, das Interesse am Computerspiel aufrechterhalten und menschliche Lebenszeit vor dem Bildschirm gebunden.
3. Wie man Macht, Herrschaft und Kontrolle im Spiel erlangt
Um mit dem Spiel „klarzukommen“, es zu „schaffen“, muß der Spieler Fähigkeiten entwickeln und einsetzen. Nur durch den angemessenen Gebrauch dieser Fähigkeiten kann der Spieler Macht, Herrschaft und Kontrolle im Spiel ausüben. Im Abschnitt 2 haben wir anhand von drei Beispielen gezeigt, in welchen recht unterschiedlichen Bereichen von Sensumotorik und Denken diese Spielforderungen liegen können. Wir wollen uns nun etwas genauer anschauen, in welcher Weise die Fähigkeiten genutzt werden müssen, um das Spiel zu kontrollieren.
Die Eigenart der virtuellen Welt besteht darin, daß man sich wahrnehmend und handelnd in dieser Welt „wiederfindet“, ohne daß man faktisch in ihr vorhanden wäre oder nach den Maßstäben der realen Welt darin handeln könnte. Virtuelle Macht, Herrschaft und Kontrolle kann man nur „mittelbar“ ausüben, obwohl manche Spiele das Gefühl erzeugen, „mitten drin“ zu sein. „Mittler“ für die virtuelle Welt können beispielsweise „elektronische Stellvertreter“ sein: „Spielfiguren“, die man „marionettenhaft“ lenken kann (wie z.B. in dem beschriebenen Spiel „Turrican“). Wie man anhand der beiden anderen Beispiele sehen konnte, sind auch andere Formen der Lenkung möglich.
Macht, Herrschaft und Kontrolle im Spiel hängen unmittelbar von der eigenen „Lenkungs-Kompetenz“ ab: von der Fähigkeit, angemessen zu lenken, was lenkbar ist. Diese Fähigkeit erweist sich in vier miteinander verwobenen Funktionskreisen, in denen der Spieler auf unterschiedliche Herausforderungen trifft: 1. die sensumotorische Synchronisierung, 2. die Bedeutungsübertragung, 3. die Regelkompetenz und 4. der Selbstbezug. Diese vier Funktionskreise könnte man als „Gelenkstück“ zwischen den Forderungen des Spiels und den Fähigkeiten des Spielers ansehen. Schauen wir uns diese Funktionskreise jetzt etwas genauer an und untersuchen wir ihre spezifischen Funktionen.5
3.1. Sensumotorische Synchronisierung (pragmatischer Funktionskreis)
Der Spieler steht in diesem Funktionskreis vor der Aufgabe, eigene Bewegungsmuster und Wahrnehmungsformen auf die programmgesteuerten Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten der Figur abzustimmen. Dazu muß er erreichen, daß seine Körperbewegungen (mit Joystick und Maus) zu angemessenen Bewegungen der Spielfigur werden. Im pragmatischen Funktionskreis hat die Spielfigur Ähnlichkeit mit einer Marionette, die ich im Spiel angemessen führen muß. Die auf dem Bildschirm ablaufenden Bildsequenzen muß ich zunächst unter dem Gesichtspunkt zielorientierter Angemessenheit wahrnehmen. Der Fluß permanenter Bilder wirkt als Rückmeldung und ist die Basis meiner sensumotorischen Synchronisierung. Ich sehe sofort, was meine Körperbewegungen (mit „Joystick“ und „Maus“) im Bildgeschehen bewirken und lerne so relativ rasch, angemessene Bewegungen und Handlungen auf dem Bildschirm zuwege zu bringen.
Die erfolgreichen Lernprozesse erlauben mir ein „Einklinken“ in ein filmartiges Geschehen, in eine „Welt am Draht“. Die „Teilhabe“ an dieser Welt erfolgt durch eine angemessene „sensumotorische Synchronisierung“, durch ein Ineinssetzen der eigenen Köperbewegungen mit den Bewegungs- und Handlungsschemata der Spielfigur. Das wiederholte Spiel führt als Übungseffekt zum Erwerb „automatisierter“ Körperbewegungen (mit „Joystick“ und „Maus“), die je nach situativem Kontext auf dem Bildschirm zu angemessenen Bewegungen der „elektronischen Marionette“ führen. Die Entwicklung der sensumotorischen Synchronisierung führt zur Erweiterung des eigenen Körperschemas (wie wir es auch beim Führen einer Marionette und beim Lenken eines Autos) beobachten können.
Bei jüngeren (bzw. ungeübteren) Spielern lassen sich häufig mimetische Reaktionen auf das Spiel beobachten. Der Spieler legt sich beispielsweise mit seinem ganzen Körper in die Kurve, wenn er mit einem „Auto“ auf dem Bildschirm die Kurve scharf nehmen will; er springt mit hoch, wenn die „elektronische Marionette“ über ein Hindernis springen soll. Mit wachsender Spielerfahrung kommt es tendenziell zu einem Abbau der mimetischen Körperreaktionen, also zu einer Rücknahme der (im Grunde unangemessenen) ganzkörperlichen Synchronisierungen.
Der pragmatische Funktionskreis hat einen Bezug zu den Funktionsspielen. Er schafft die sensumotorischen Voraussetzungen für die weiteren Funktionskreise des Bildschirmspiels. Wie das Funktionsspiel Freude an der (gekonnten) Bewegung bewirken kann, so entsteht durch den sensumotorischen Funktionskreis im Spieler das befriedigende Gefühl, die Spielfigur (wie den eigenen Körper) beherrschen zu können. Im sensumotorischen Funktionskreis „belebe“ ich meinen „elektronischen Stellvertreter“ mit meiner eigenen Körperlichkeit: Ein Teil meines Körpers wird zur „elektronischen Marionette“.
Nun gibt es zahlreiche Bildschirmspiele, bei denen ein „elektronischer Stellvertreter“ in Form einer zu steuernden Spielfigur offensichtlich fehlt. Dies gilt insbesondere für Spiele, die dem Bereich „Denken“ zuzuordnen sind. Bei diesen Spielen (insbesondere bei den Strategiespielen) gibt es kein trickfilmartiges Geschehen, sondern lediglich Spielelemente, die wie bei einem Brettspiel versetzt und verändert werden. Der Spieler ist nicht sensumotorisch im Spiel „drin“, sondern befindet sich „außerhalb“. Von dieser Position wirkt er auf das Spielgeschehen wie bei einem Anwendungsprogramm mit Benutzeroberfläche ein. Das spielerische Handeln personifiziert sich nicht mehr mit einer einzelnen Figur, sondern findet sich im „Gewebe“ des gesamten Spiels wieder.
Dies führt zu entscheidenden Veränderungen im pragmatischen Funktionskreis. Ich führe nicht mehr eine „elektronische Marionette“, sondern ich „bin“ ein Teil der „Welt am Draht“, weil wesentliche Elemente dieser Welt Teile von mir werden, auf die ich unmittelbar und mittelbar Einfluß habe – und Einfluß nehmen muß, soll meine „kleine Welt“ in der etwas größeren Welt des Bildschirmspiels Bestand haben.
Folgender bildhafter Vergleich mag vielleicht die Unterschiede etwas verdeutlichen: Der Spieler schlüpft in den „elektronischen Stellvertreter“ wie in einen Handschuh und lernt, die Finger angemessen zu bewegen und mit der behandschuhten Hand zielorientiert zu handeln. Genauso schlüpft man in die „Haut“ komplexer Strategiespiele und lernt, sich in dieser neuen Haut angemessen zu bewegen. Indem man das Spiel verstehen lernt, „belebt“ man die Hautoberfläche, bis man – nach vielen Spielerfahrungen – ein Gefühl bis in die Fingerspitzen bekommt und man voll im Spiel drin ist.
3.2. Bedeutungsübertragung (semantischer Funktionskreis)
Das Geschehen auf dem Bildschirm wird vom Spieler „gedeutet“. Die Bildschirmelemente „deuten“ auf einen mehr oder weniger bestimmten Gehalt. In seiner Wahrnehmung „re“konstruiert der Spieler das Spiel in der Regel in Richtung auf die von den Spieldesignern angesonnenen Bedeutungsgehalte. Er wird dabei sowohl vom Bildschirmgeschehen und seinen einzelnen Bild- und Tonelementen angeregt, als auch von der Spielgeschichte, den verschiedenen Szenen und den in der Spielanleitung enthaltenen Beschreibungen und Ausdeutungen. In Anlehnung an seine in der Sozialisation erfahrenen kulturellen Muster findet sich der Spieler z.B. in einer „Weltraumschlacht“, bei einer „Autofahrt“ oder auf einem „Fußballplatz“ wieder.
Mit der Übertragung von Bedeutung verbinden sich kulturelle Erfahrungen, moralische Bewertungen und dadurch bedingte unterschiedliche Gefühle mit dem Spiel. All dies bewirkt, daß Spieler bestimmte Einstellungen zu den unterschiedlichen Spielen finden. Dies kann bereits vor dem eigentlichen Erproben des Spiels eintreten, beispielsweise wenn stark aggressive Bildobjekte das Spiel dominieren und damit bei manchen Spielern (auf dem Hintergrund kultureller Normierungen) negative Einstellungen dem Spiel gegenüber auslösen.
Die Bedeutung der Spielelemente ist in der Regel sehr eng mit ihren Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten verküpft. Ein als „Flugzeug“ gedeutetes Bildobjekt zeigt zahlreiche für ein solches Fluggerät typischen „Muster“: Starten und Landen, Erhöhen und Verringern der Geschwindigkeit, Richtungsänderungen, Verändern der Flughöhe und vieles andere. Durch die Übernahme der angesonnenen Bedeutungen gewinnt der Spieler ein Verständnis für die Zustandsveränderungen der Spielobjekte auf dem Bildschirm. Er kann besser behalten, welche Bewegungsmöglichkeiten seine Spielfigur hat, weil diese Möglichkeiten sich aus der Bedeutung der Figur erschließen lassen.
Der semantische Funktionskreis hat einen Bezug zu den Symbolspielen. Das Symbolspiel gewinnt seinen Reiz aus der Verwandlung: der Spielgegenstand kann eine andere Bedeutung, der Spieler eine andere Rolle annehmen. Das Geschehen erhält eine andere Bedeutung und dadurch einen für den Spieler besonderen Reiz.
Das Bildschirmspiel bietet wie das Symbolspiel die Möglichkeit zur Verwandlung und die Chance, ein anderes „Leben“ in einer anderen Rolle leben zu dürfen und darin auf dem Bildschirm ernst genommen zu werden: als Flugkapitän ebenso wie als Kämpfer auf dem Schlachtfeld, als Ritter ebenso wie als waghalsiger Autorennfahrer.
Im semantischen Funktionskreis „belebe“ ich meinen „elektronischen Stellvertreter“ durch die Bedeutung, die ich ihm in Bezug auf meinen kulturellen Hintergrund gebe. Indem ich die Spielfigur in Hinblick auf meine kulturellen Muster deute, wird sie als eine andere Rolle für mich bedeutsam.
3.3. Regelkompetenz (syntaktischer Funktionskreis)
Im Bildschirmspiel ist man nicht so „frei“ wie beim Führen einer Marionette. Das spielerische Handeln ist vielmehr an feste Regeln gebunden. Diese Regeln legen die Art und die Beziehungen der Objekte zueinander fest. Die „Welt“ entfaltet sich, indem „ich“ in der Hülle meines „elektronischen Stellvertreters“ handle. In meinem Handeln werden mir zugleich die Regeln dieser „Welt“ bewußt. Indem ich die Regeln nach und nach erkenne und lerne, sie für meine Spielziele zu nutzen, kommt Spannung im Spiel auf: Bringe ich es zuwege, als erster ins Ziel zu kommen? Schaffe ich es, meinen Endgegner zu besiegen? Gelingt es mir, meinen Umsatz entscheidend zu steigern? Die durch den syntaktischen Funktionskreis bewirkten Leistungsforderungen und Spannungselemente lösen gefühlsmäßige Reaktionen des Spielers in Hinblick auf den Spielverlauf und das Spielergebnis aus: Freude, Stolz, Enttäuschung, Verärgerungen, Überraschung. Hand in Hand mit der Spannung des Spiels steigt die Anspannung der Spieler: Sie müssen die Welt von ihren Regeln her verstehen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten nutzen und die angemessenen Strategien entwickeln.
Das Hineinwachsen in die „virtuelle Welt“ ist verbunden mit einer zunehmenden Komplexität bei der Strukturierung der spielbezogenen Wahrnehmungen und der daraus hergeleiteten Spielhandlungen.6
1. Zunächst bilden sich aus den Mustern von Impulsen aus den sensorischen Bereichen des Sehens und des Hörens relativ unspezifische Sinneseindrücke.
2. Aus den Mustern von Sinneseindrücken „konstruiert“ der Spieler die verschiedenen Spielobjekte (Flugzeuge, Häuser, Pflanzen, Tiere). In der Regel entwickeln sich diese „Konstruktionen“ sehr rasch in Richtung auf die von den Spieldesignern programmierte Objektwelt. Die Spieler erkennen das Gemeinte.
3. Die vom Spieler beobachteten relativen Veränderungen der Objekte während des Spielablaufs führen dazu, daß er ihnen bestimmte Eigenschaften zumißt (z.B. nützlich, gefährlich; schnell, langsam).
4. Die relativen Veränderungen der Spielobjekte lassen sich zu Ereignissen oder Geschehensabläufen ordnen. Der Spieler erkennt z.B., daß der „Drache“ immer dann zum Angriff übergeht, wenn die eigene Spielfigur ein bestimmtes Objekt in der Spiellandschaft (z.B. einen Baum) erreicht hat.
5. Dies führt im nächsten Schritt dazu, daß der Spieler lernt, Beziehungen zwischen den verschiedenen Spielobjekten und ihren Eigenschaften herzustellen. Nach einigen Spielerprobungen weiß der Spieler beispielsweise, daß „Drachen“ bei Annäherung stes angreifen und daß man ihnen tunlichst aus dem Weg gehen sollte, wenn man nicht die Eigenschaften (in diesem Falle „Waffen“) besitzt, um den Kampf erfolgreich zu bestehen.
6. Aus den verschiedenen Spielerfahrungen entwickelt der Spieler Spielstrategien: Er organisiert zeitlich und räumlich die Beziehungsstrukturen und Handlungsabläufe. Beispielsweise verkauft er zunächst bei einem Händler einen Edelstein, um von dem Geld beim Schmied ein wirkungsvolles Schwert zu erwerben. So gewappnet kann er dann den Kampf mit dem Drachen wagen, den er zunächst aus einem bestimmten Bereich herauslocken muß, um ihn besiegen zu können.
7. Der nächste Schritt in der Ausfaltung der Systemkomplexität besteht darin, verschiedene Strategien sinnvoll miteinander zu verknüpfen und aufeinander abzustimmen. So läßt sich unser „Drache“ beispielsweise nur mit einem Topf Honig aus der Höhle locken. Um zu diesem Honig zu kommen, muß eine zweite Spielfigur ein Honignest finden, das man plündern kann. Diese zweite Figur sollte dann mit dem Honig rechtzeitig zur Stelle sein, wenn der Kampf mit dem Drachen ansteht.
8. Der mit diesem „Adventure“ vertraute Spieler ordnet seine Strategien nach bestimmten Kriterien und wird damit in die Lage versetzt, mit unterschiedlichen Situationen fertigzuwerden. Die sich so entwickelnden Situationsklassen (Prinzipien) stellen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster auf einer relativ hohen Systemebene bereit. Der Spieler kennt dann erprobte Prinzipien, nach denen er mit blauen, roten und gelben Drachen umzugehen hat, wenn er erfolgreich sein will. Eines dieser Prinzipien könnte beispielsweise lauten, sich erst dann auf einen Kampf einzulassen, wenn man genügend gewappnet ist und die Schwächen des Gegners erkannt hat.
9. Auf einer noch höheren Systemebene entstehen aus den Spielprinzipien für das Handeln im Spiel strukturelle Erkenntnisse, die sich auf das jeweilge Spielgenre insgesamt beziehen. Der mit zahlreichen Adventures vertraute Spieler weiß, was es von Spielen dieser Art zu halten hat, wie er damit grundsätzlich umgehen muß, um Erfolg zu haben.
Der syntaktische Funktionskreis der Computerspiele zeichnet sich dadurch aus, daß der Spieler von einer Ebene der Regelorientierung in die Ebene nächsthöherer Komplexität „aufsteigt“. Jede einzelne Ebene des Regelsystems wird im Laufe des Lernprozesse der Spieler durch die Erkenntnis weiterer Regelelemente und ihrer Verbindungen so weit differenziert, bis der Spieler in die nächste Ebene gelangt, wobei sich jede neue Ebene durch das Ausmaß der Vernetzung ihrer einzelnen Elemente von der vorhergehenden unterscheidet.
Das Spiel selbst gibt immer wieder Gelegenheit, die Wirksamkeit der erreichten Systemebene zu überprüfen. Gelange ich mit der vorgesehenen Strategie zum Ziel? Sind die von mir für dieses Spiel gefundenen Prinzipien in den verschiedenen Spielsituationen wirkungsvoll?
Der Spieler wird durch den syntaktischen Funktionskreis dazu gebracht, aus der Hülle seines „elektronischen Stellvertreters“ heraus Ideen für spielbezogene Wahrnehmungen und spielerisches Handeln zu entwickeln. Diese muß er dann so organisieren und miteinander verknüpfen, daß er die Spielziele erreichen kann.
Der syntaktische Funktionskreis hat einen deutlichen Bezug zu den Regelspielen. Er schafft die regelorientierte Grundlage für das spielerische Handeln. Wie bei jedem Regelspiel ist auch beim Bildschirmspiel der Spielerfolg wichtig. In der Gestalt des „elektronischen Stellvertreters“ erreicht der Spieler diesen Erfolg, wenn er sich auf die Regeln des Spiels einläßt und sie auf den verschiedenen Systemebenen des Spiels zu verstehen lernt. Im syntaktischen Funktionskreis „belebe“ ich meinen „elektronischen Stellvertreter“ durch meine „Regelkompetenz“: durch mein kognitives System, das es mir möglich macht, Regeln zu erkennen, auf immer höheren Ebenen zu ordnen und zu verknüpfen, um in einer „Welt am Draht“ handlungsfähig zu werden. Gelingt es mir, diese „Welt“ angemessen zu kontrollieren und die Ereignisfolgen zu beherrschen, entsteht, wie bereits schon im sensumotorischen Funktionskreis, das befriedigende Gefühl von Kompetenz und Wirkkraft.
3.4. Selbstbezug (dynamischer Funktionskreis)
Der pragmatische, der semantische und der syntaktische Funktionskreis schaffen die Voraussetzungen, daß sich die Spieler mit dem Bildschirmspiel sensumotorisch und kognitiv überhaupt in Beziehung setzen können. Die Kraft und Energie, mit der sie es tun, erklärt der dynamische Funktionskreis. Die (motivationale) Kraft erwächst dadurch, daß Thematiken, Rollenagebote, Skripte, Episoden und einzelne Szenen des Spiels zum eigenen Lebensbereich, seinen kulturellen Hintergründen, Rollen, Lebensthematiken, einzelnen Episoden und Szenen in Beziehung gesetzt wird. Durch den Selbstbezug werden Bildschirmspiele zu einem mehrfädig geflochtenen Band bedeutsamer Metaphern, die in ihren vielfältigen Verweisungen Individuelles mit Gesellschaftlichem verbinden.
Das Spiel auf dem Bildschirm weist vielfältige Anknüpfungspunkte zu den Erfahrungen, Wünschen und Handlungsbereitschaften der Spieler auf. Erst wenn sich der Spieler in „seinem“ Spiel „wiederfindet“, kann es für ihn Faszinationskraft erlangen. Der Spieler löst aus dem Spiel die Aspekte heraus, die für ihn und sein Leben wichtig sind. Damit wird das Bildschirmspiel zu einer „Metapher“ des eigenen Lebens. Die Spielfigur und ihr Erfolg im Spiel werden mit der eigenen Person und ihren Lebenskontexten verbunden. Man „erkennt“ sich im Spiel und „lebt“ dort sein „Leben“.
Der Selbstbezug kann an bevorzugten Spielinhalten deutlich werden. So mögen Jugendliche, die selbst viel Sport treiben, besonders gerne Sportspiele auf dem Bildschirm. Spieler, die sich in aggressiv getönten Lebenskontexten zurechtfinden müssen, greifen häufig zu Spielen, bei denen es um körperliche Auseinandersetzungen geht. Menschen, die viel organisieren müssen, bevorzugen Spiele, in denen gerade diese Fähigkeit verlangt wird.
Der Selbstbezug bei Bildschirmspielen ist auf bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens ausgerichtet. Untersucht man die grundlegenden Handlungsszenen, die alle Spiele „musterartig“ durchziehen, kommt man auf einige wenige „Grundmuster“: a) Kampf, b) Erledigung, c) Bereicherung und Verstärkung (personale Ausdehnung), d) Verbreitung (räumliche Ausdehnung), e) Ziellauf, f) Prüfung und Bewährung und schließlich g) Ordnung. Diese Grundmuster machen die Dynamik der Bildschirmspiele aus und geben ihr eine jeweils charakteristische „Gestalt“ und Anmutung. Sie sind auch das „Gelenkstück“ für Bezüge zur Lebenssituation und zu Lebensthematiken der Spieler.
Die Grundmuster der Bildschirmspiele, so sehr sie sich auch mit anderen Inhalten befrachten, verweisen auf bestimmte Aspekte in den Lebensthematiken und kulurell-gesellschaftlichen Verhaltensmustern der Spieler: a) Auseinandersetzungen führen und Konflikte mit anderen Menschen austragen, b) Aufgaben zur Zufriedenheit erledigen, c) reicher werden, an Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen, d) den eigenen Wirkungskreis erweitern, die Einflußzonen vergrößern, e) als Erster eine Aufgabe erfüllen und ans Ziel gelangen, f) Prüfungs- und Bewährungssituationen bestehen, g) Elemente des Lebens in eine sinnvolle (brauchbare, nützliche) Ordnung bringen.
Untersucht man die „Grundmuster“ der Bildschirmspiele auf ihre möglichen Gemeinsamkeiten, findet man in ihnen die Ausrichtung auf das Ziel, das „Bleiberecht“ in den „Welten am Draht“ damit zu behaupten. Dazu muß der Spieler über das Spiel und damit über sich selbst die Kontrolle erlangen. Das Spiel am Bildschirm wird dadurch in seinem Kern zu einem Spiel um Macht, Kontrolle und Herrschaft. Der Macht programmierter Ereignisfolgen muß der Spieler seine in den verschiedenen Funktionskreisen erlangte Handlungsmacht entgegensetzen. Indem er sich selbst kontrolliert (Wünsche, Gefühle, Kognition, Anspannung und Konzentrationskraft) beginnt er, Kontrolle über das Spiel auszuüben und damit die Ereignisfolgen so zu bestimmen, daß sein „Bleiberecht“ im Spiel gesichert wird. Die Faszinationskraft der Bildschirmspiele ist zu einem nicht unwesentlichen Teil von diesem Spiel um Macht, Kontrolle und Herrschaft bestimmt. Die „Inszenierung“ dieses Spiels macht den zweiten wesentlichen Teil der Faszinationskraft aus. Das Spiel um Kontrolle und Herrschaft muß in einer „Welt“ stattfinden, die dem jeweiligen Spieler zusagt und die das Spektrum an Fähigkeiten fordert, die dem Spieler angemessen sind.
Der dynamische Funktionskreis ähnelt in seiner Wirkkraft psychodynamischen und psychodramatischen Spielarrangements, die das Ziel haben, die Innenwelt dadurch zum Ausdruck kommen zu lassen, daß ihr eine Reizkonfigaration angeboten wird, zu der sie sich in Beziehung setzen kann.
Das Drama auf dem Bildschirm wird (meist unbewußt) als Metapher für das reale Leben verstanden. Aus diesem Grunde können sich die Spieler zu dem Spiel in Beziehung setzen, es mit Leben füllen: ihrem Leben. Sie finden sich in dem Spiel wieder, weil sie im Spiel das Drama ihres Lebens wiederfinden und es auf der Folie eines Spiels zu beherrschen lernen. Im dynamischen Funktionskreis findet sich der Spieler mit seinen narzißtischen Wünschen (Macht, Beherrschung, Kontrolle, Reichtum, Kraft) ebenso wieder, wie mit seinen erworbenen gesellschaftlich und kulturellen Wertvorstellungen, Normen und Einstellungen. Im Spielgeschehen koppelt er die Skripte des Bildschirmspiels mit der eigenen Erfahrungswelt, den Handlungsbereitschaften und Erwartungsstrukturen und verbindet so die Spieldynamik des Bildschirmspiels mit den psychodynamischen und soziodynamischen Anteilen seiner Person. Die virtuelle Wirklichkeit des Spiels wird für den Spieler wirklich, weil er sie mit seiner inneren Wirklichkeit wirksam verbunden hat.
Die Abbildung verdeutlicht die verschiedenen Funktionskreise des Bildschirmspiels und ihre speziellen Wirkungen und Funktionen. Die Funktionskreise beinhalten die Zugangsformen, um Macht, Kontrolle und Herrschaft über die Computerspiele ausüben zu können. Indem der Spieler sich die verschiedenen Zugangsformen zum Spiel erschließt, ist er „im Bildschirm drin“, weil er gelernt hat, diese virtuelle Macht, Kontrolle und Herrschaft wirkungsvoll auszuüben. Computer sind „Generatoren von Wirklichkeit“: Ihre Fähigkeit besteht darin, die unterschiedlichsten Realitäten zu schaffen, in denen Menschen (partiell) leben können.7 Die Funktionskreise beschreiben die sensumotorischen, kognitiven und emotionalen Forderungen, um in den virtuellen Welten der Computerspiele „leben“ zu können und, weil man es zu beherrschen gelernt hat, von diesem „Leben“ fasziniert zu sein.
3.5. Macht durch Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle
Computerspiele tragen das Stigma von Macht, Kontrolle und Herrschaft in mehrfacher Hinsicht. Die „Dramaturgie“ der Spiele enthält Muster für Macht, Kontrolle und Herrschaft. Dies korrespondiert mit dem Inhalt der Spiele: mit seinen Beherrschungsobjekten und Beherrschungssituationen. Die Forderungsstruktur der Spiele setzt dies ungebrochen fort. Es gilt, das Spiel zu beherrschen, also zu durchschauen und angemessene Handlungsmuster zu entwickeln.
Dazu ist Selbstbeherrschung notwendig. Um der Forderungsstruktur zu genügen, muß die Herrschaft über die eigene Psyche auch in Spielsituationen errungen werden. Dies drückt sich beispielsweise in Streßresistenz, Ausdauer, Wachheit und Konzentrationskraft aus. Ein Ansteigen von Anspannung und Streß beeinträchtigt die Leistungsvoraussetzungen der Spieler: Erfolge können sich so nicht einstellen. Die Spieler müssen also lernen, nicht nur das Spiel zu kontrollieren, sondern auch sich selbst in ihren gefühlsmäßigen Reaktionen. Gelingt dies, verändert sich die gefühlsmäßige Tönung der Spieler: Sie bleiben zwar hoch konzentriert, erleben sich nun jedoch als ruhig, locker, entspannt, geordnet, fröhlich. Schaffen es die Spieler, aus der Spirale von Anspannung und Mißerfolg auszubrechen, ändern sich auch bei schwierigen Spielen die gefühlsmäßigen Reaktionen: „Ich fühl
Diskussionsverlauf:
- Für Jenere/Macht ~ - 13.12.2004 11:17 (3)
- Macht/Ohnmacht u. Spiele ~ - 14.12.2004 10:25
- Für Jenere/Macht -2 ~ - 13.12.2004 11:20
- Boritschi Fighter ? ~ - 13.12.2004 13:51